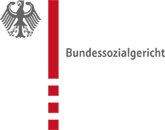Verhandlung B 3 KR 8/21 R
Krankenversicherung - Hilfsmittelversorgung - Steh- und Gehtrainer Innowalk
Verhandlungstermin
14.06.2023 14:00 Uhr
Terminvorschau
V. B. ./. Techniker Krankenkasse, beigeladen: 1. GKV-Spitzenverband, 2. Gemeinsamer Bundesausschuss
Im Streit steht die Versorgung mit dem Steh- und Gehtrainer Innowalk.
Der 2002 geborene, bei der beklagten Krankenkasse versicherte Kläger leidet von Geburt an unter einer Fehlbildung der Wirbelsäule und des Rückenmarks (Spina bifida mit Myelomeningozele), die eine Lähmung der unteren Extremitäten und eine erhebliche Einschränkung der Mobilität bedingen. Nach erfolgreicher Erprobung beantragte er aufgrund ärztlicher Verordnung die Versorgung mit dem Steh- und Gehtrainer Innowalk medium für eine 12-monatige Miete zu Kosten von 8383,55 Euro. Dabei handelt es sich um ein feststehendes, motorisiertes Trainingsgerät, das bei Funktionseinbußen der unteren Extremitäten infolge einer Schädigung des Gehirns beziehungsweise einer neuromuskulären Erkrankung eingesetzt werden soll und für die regelmäßige Nutzung im häuslichen Bereich unter Aufsicht als Ergänzung zur Physio- beziehungsweise Ergotherapie konzipiert ist. Das ein Steh- und Gehtraining kombinierende Wirkprinzip soll so zur Dehnung und Kräftigung der für das Stehen und Gehen essenziellen Muskelgruppen beitragen, dass die Patientin oder der Patient im Idealfall wieder Gewicht auf die Beine selbst übernehmen und stehen kann.
Das Sozialgericht hat die Beklagte unter Aufhebung der ablehnenden Bescheide antragsgemäß zur Versorgung für eine Mietdauer von zwölf Monaten verurteilt. Das Landessozialgericht hat das Urteil des Sozialgerichts aufgehoben und die Klage abgewiesen: Nach dem von ihm eingeholten Sachverständigengutachten sei der Steh- und Gehtrainer im Fall des Klägers zwar anderen Hilfsmitteln zur Sicherung des Erfolgs der Krankenbehandlung eindeutig überlegen. Der begehrten Versorgung stehe jedoch die Sperrwirkung des § 135 Absatz 1 SGB V entgegen, weil die Kombination aus Stehständer und fremdkraftbetriebenem Beintrainer gegenüber etablierten Hilfsmitteln erhöhte Risiken berge, die eine positive Bewertung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss erforderlich machten.
Mit seiner vom Landessozialgericht zugelassenen Revision rügt der Kläger die Verletzung von § 27 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 in Verbindung mit § 33 Absatz 1 SGB V. Das Hilfsmittel diene primär dem unmittelbaren und auch mittelbaren Ausgleich einer bestehenden Behinderung, nämlich der fehlenden Steh- und Gehfähigkeit, durch Vertikalisierung und Erlernen von Bewegungsabläufen in aufrechter Körperposition sowie durch die Möglichkeit zur ausreichenden Bewegung. Es beuge auch einer drohenden Behinderung vor, nämlich der dauerhaften und irreversiblen Immobilität. Das Hilfsmittel sei keine neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode, weshalb der Vorbehalt des § 135 Absatz 1 SGB V nicht greife, auch nicht wegen einer Gefährlichkeit der Selbstanwendung, denn es bestünden angesichts der Sicherheitsvorkehrungen keine gegenüber bereits gelisteten Hilfsmitteln erhöhten Anwendungsrisiken. Als Verfahrensmängel des Landessozialgerichts rügt der Kläger eine Verletzung seines rechtlichen Gehörs durch eine Überraschungsentscheidung und eine Verletzung der Amtsermittlungspflicht. Erstmals mit dem Urteil habe das Landessozialgericht auf seine zuvor nicht erkennbare Auffassung von den erhöhten Anwendungsrisiken des Hilfsmittels hingewiesen, die eine positive Bewertung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss erforderlich machen würden; unter Zugrundelegung dieser Auffassung hätte sich das Landessozialgericht zu weiteren Ermittlungen zu Anknüpfungstatsachen für solche Risiken gedrängt fühlen müssen.
Der zu 2 beigeladene Gemeinsame Bundesausschuss hat auf Anfrage des zu 1 beigeladenen GKV-Spitzenverbands im Antragsverfahren des Herstellers auf Aufnahme des Hilfsmittels in das Hilfsmittelverzeichnis beschlossen, dass der Einsatz des Innowalk für das Steh- und Gehtraining bei ausgeprägten Funktionsstörungen der unteren Extremitäten nicht untrennbarer Bestandteil einer neuen Untersuchungs- oder Behandlungsmethode sei; er sei zwar untrennbarer Bestandteil einer Untersuchungs- oder Behandlungsmethode, diese aber nicht neu (Beschluss vom 12.1.2023; Tragende Gründe vom 12.1.2023).
Verfahrensgang:
Sozialgericht Karlsruhe, S 10 KR 1272/19, 19.11.2019
Landessozialgericht Baden-Württemberg, L 11 KR 4247/19, 10.08.2021
Sämtliche Vorschauen zu den Verhandlungsterminen des Senats an diesem Sitzungstag finden Sie auch in der Terminvorschau 21/23.
Terminbericht
Die Revision des Klägers war begründet. Nach Abschluss des Klärungsverfahrens zur Neuheit der mit dem Steh- und Gehtrainer Innowalk verfolgten Behandlungsmethode durch den beigeladenen Gemeinsamen Bundesausschuss ist der Einsatz dieses Hilfsmittels in der ambulanten Versorgung nicht mehr gesperrt und die Beklagte antragsgemäß zu dessen leihweiser Überlassung an den Kläger verpflichtet.
Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden dürfen in der vertragsärztlichen Versorgung zu Lasten der Krankenkassen nur erbracht werden, wenn der Gemeinsame Bundesausschuss auf Antrag Empfehlungen abgegeben hat über unter anderem die Anerkennung des diagnostischen und therapeutischen Nutzens der neuen Methode sowie deren medizinische Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit nach dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Entsprechend darf ein Hilfsmittel in das von dem beigeladenen GKV-Spitzenverband zu führende Verzeichnis von zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung abzugebender Hilfsmittel nicht eingetragen werden, wenn die zu Grunde liegende Behandlungsmethode ohne positive Empfehlung des Gemeinsamen Bundesausschusses in der ambulanten Versorgung nicht angewandt werden darf und eine solche Empfehlung nicht vorliegt. Demgemäß ist die Abgabe solcher Hilfsmittel in der ambulanten Versorgung ebenfalls gesperrt, solange der Gemeinsame Bundesausschuss die jeweils zu Grunde liegende Methode nicht positiv bewertet hat. Geboten ist die Bewertung einer Methode durch den Gemeinsamen Bundesausschuss in Bezug auf deren Neuheit bei einer Hilfsmittelversorgung nach der Rechtsprechung des Senats daher insbesondere, wenn sie sich im Vergleich zu herkömmlichen Therapien deshalb als "neu" erweist, weil sie hinsichtlich des medizinischen Nutzens, möglicher Risiken und in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit wesentliche, bisher nicht geprüfte Änderungen aufweist.
Das gilt bei einem in diesem Sinne untrennbar mit einer neuen Behandlungsmethode verbundenen Hilfsmittel regelmäßig auch dann, wenn mit ihm neben kurativen oder präventiven Zwecken auch weitere Versorgungsziele zu verfolgen sind, wie insbesondere solche, die im Sinne der vom Senat fortgeführten Rechtsprechung dem unmittelbaren Behinderungsausgleich zuzuordnen sind. Auch zum Behinderungsausgleich dürfen Hilfsmittel zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung nur abgegeben werden, wenn Qualität und Wirksamkeit dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechen und die Versorgung dem Wirtschaftlichkeitsgebot genügt. Wirft das in Bezug auf Nutzen, Risiken und Wirtschaftlichkeit beim Behinderungsausgleich vergleichbar neue Fragen auf wie beim Einsatz zu Behandlungszwecken, kann das im Hinblick auf den Bewertungsvorrang des Gemeinsamen Bundesausschusses für die zur ambulanten Versorgung zuzulassenden Methoden nur einheitlich von ihm beurteilt werden. Soweit hierzu Feststellungen zum allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse zu treffen sind, obliegen diese deshalb mindestens bei jedenfalls auch zu kurativen oder präventiven Zwecken bestimmten Hilfsmitteln ausschließlich dem Gemeinsamen Bundesausschuss und weder dem verordnenden Arzt noch der in Anspruch genommenen Krankenkasse, wenn sie in medizinischer Hinsicht wesentliche, bisher nicht geprüfte Neuerungen im Vergleich zu in der ambulanten Versorgung bereits etablierten Leistungen betreffen; ob das rechtsähnlich auch für Hilfsmittel gilt, die bei kurativ nicht weiter therapierbaren Ausfällen einer Körperfunktion auf deren Ausgleich mit innovativen Methoden zielen, die in Bezug auf Nutzen, Risiken und Wirtschaftlichkeit entsprechende wesentliche Fragen in medizinischer Hinsicht aufwerfen, kann hier offen bleiben.
Zutreffend haben hiernach das Landessozialgericht und auf den Antrag des Herstellers auf Eintragung des Steh- und Gehtrainers Innowalk in das Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenversicherung ebenso der GKV-Spitzenverband geprüft, ob die zu Grunde liegende Methode im Vergleich zu bereits anerkannten Methoden so deutliche Unterschiede aufweist, dass eine selbständige Bewertung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss erforderlich ist; das gilt unbeschadet dessen, ob das Hilfsmittel ausschließlich der kurativen Versorgung zuzurechnen ist oder mit einem relevanten Anteil auch dem Behinderungsausgleich. Ob ein in der gesetzlichen Krankenversicherung bis dahin nicht zum Einsatz gekommenes Hilfsmittel ohne Bewertung der zu Grunde liegenden Methode durch den Gemeinsamen Bundesausschuss in die ambulante Versorgung eingeführt werden kann oder nicht, obliegt im Zweifel vorrangig der Beurteilung seines zuständigen Beschlussgremiums. Das gilt insbesondere für Hilfsmittel, die Wirkprinzipien verschiedener bereits in der Versorgung eingeführter Methoden verbinden, wie vorliegend der Steh- und Gehtrainer Innowalk mit Elementen der Vertikalisierung und des fremdkraftgestützten Beintrainings. Ob eine solche Kombination im Hinblick auf Nutzen, Risiken und Wirtschaftlichkeit nach dem Schutzzweck des § 135 Absatz 1 SGB V einer neuen Bewertung durch das dazu berufene - und entsprechend interessenplural zusammengesetzte - Beschlussgremium des Gemeinsamen Bundesausschusses zu unterziehen ist oder ob sich die Voraussetzungen für die Versorgung und die dabei einzuhaltenden Maßgaben hinreichend sicher aus den bereits eingeführten Einzelelementen der fraglichen Methode ableiten lassen, ist zuvörderst eine vom Gemeinsamen Bundesausschuss selbst zu klärende Frage. Solange das nicht geschehen ist, entfaltet die Regelung des § 135 Absatz 1 SGB V deshalb vorwirkende Sperrwirkungen im Hinblick auf jedes in der gesetzlichen Krankenversicherung neu einzusetzende Hilfsmittel, bei dem sich Fragen zur Erforderlichkeit einer Methodenbewertung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss ernstlich stellen; das hat das Landessozialgericht zu Recht beachtet.
Gelangt der Gemeinsame Bundesausschuss auf entsprechende Anfrage mit Blick auf seine Aufgabe auch einer Risikoabschätzung bei innovativen Hilfsmitteln mit therapeutischen Zwecken und bei deren Nutzung zur Eigenanwendung im häuslichen Bereich in Orientierung an den Schutzzwecken des § 135 Absatz 1 SGB V zu der Einschätzung, dass ein eigenständiges Bewertungsverfahren nicht durchzuführen ist, dann entfaltet dies in den jeweiligen Regelungszusammenhängen Bindungswirkung für Versicherte, Krankenkassen, Leistungserbringer und den GKV-Spitzenverband, soweit nicht Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Gemeinsame Bundesausschuss den Spielraum im Rahmen seines Normsetzungsermessens überschritten haben könnte, wofür hier nichts spricht. Für den Rechtsstreit hier steht danach fest, dass Versicherte die Versorgung mit dem Steh- und Gehtrainer Innowalk unter den Voraussetzungen und mit den Maßgaben zur häuslichen Anwendung beanspruchen können, die aus den ihm zu Grunde liegenden und in dem Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses im Einzelnen angeführten Methoden abzuleiten sind, was nach den Feststellungen des Landessozialgerichts im Fall des Klägers dessen Anspruchsberechtigung begründet.
Sämtliche Berichte zu den Verhandlungsterminen des Senats an diesem Sitzungstag finden Sie auch in dem Terminbericht 21/23.